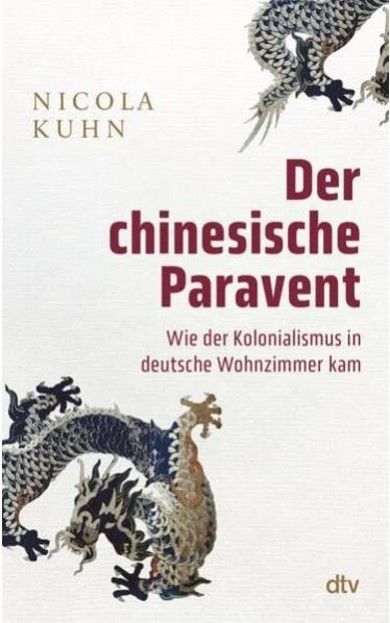Der chinesische Paravent - Wie der Kolonialismus in deutsche Wohnzimmer kam heißt ein Buch von Nicola Kuhn, Kunstredakteurin des Tagesspiegels. Es wurde 2024 veröffentlicht und in den Medien recht breit und positiv rezipiert. Die Autorin geht anhand von außereuropäischen Artefakten in deutschen (und einer österreichischen) Familien der Frage nach, wie und vor allem durch wen diese während der Kolonialzeit nach Deutschland kamen und wie heute damit umgegangen wird. Die Artefakte sind Ausgangspunkte für 11 Reisen in deutsche Vergangenheit und Gegenwart.
Inhalt
11 Geschichten erzählt Nicola Kuhn in ihrem Buch und beginnt in ihrer eigenen Familie. In ihrem Elternhaus hängt ein Paravent, der der Familienlegende nach ein Geschenk des chinesischen Kaisers an den Urgroßvater war. Kuhn greift dies auf und recherchiert intensiv über das Objekt und ihren Vorfahren. Dabei taucht sie in die Geschichte des deutschen Kolonialismus in China ein, als ihr Großvater Carl Bödiker in Tsingtau (heute Qingdao) die dort stationierten kaiserlichen Truppen Lebensmitteln oder auch Zigarren lieferte. Damit war er auch am ‚Boxerkrieg‘, dem Aufstand der ‚Bewegung der Verbände für Gerechtigkeit und Harmonie‘, beteiligt. Später weitete Bödiker seine Geschäfte bis nach Afrika aus und belieferte die Truppen, die die Aufstände der Herero und Nama niederschlugen - heute gilt dies als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts.
Auch der Protagonist der zweiten Geschichte war in Tsingtau tätig. Ludwig Winter war dort Gouvernementspfarrer und brachte Silbergeschirr nach Deutschland mit. Das Material dafür war vermutlich eingeschmolzene mexikanische Silberdollars, die Hauptwährung in den Küstenstädten. Das Silbergeschirr wurde wahrscheinlich für den Export hergestellt.
In weiteren Episoden beleuchtet die Autorin die Verstrickung prominenter und weniger prominenter Persönlichkeiten in den Kolonialismus, wobei der Aufmacher jeweils ein Familienstück ist. Wie der Papagei Polly Symbol dafür ist, wie Hermann von Wissmann immer noch relativ unreflektiert in einem Privatmuseum der Familie geehrt wird. Wissmann ist berüchtigt für seine Grausamkeit gegenüber der Bevölkerung in ’Deutsch-Ostafrika‘. Interessanterweise stammt der Papagei aber wohl nicht aus diesem Erdteil.
Sie erinnert an Max Pechstein oder den Verleger Hans Mayer. Genauso wichtig ist ihr aber auch die Episode des wenig bekannten Carl Oppermann, Zahlmeister auf einem Marinekreuzer. Er brachte von seinen Fahrten in Papua-Neuguinea eine Trommel mit.
Kuhn geht aber nicht nur auf diejenigen ein, die mehr oder weniger in den Kolonialismus verstrickt waren, sondern auch darauf, wie die Besitzer heute mit den Familienstücken und ihrer Geschichte umgehen. So gibt es Tendenzen zur Relativierung nach dem Motto: 'Er war eben ein Kind seiner Zei't. Vereinzelt wird das Erbe in Ehren gehalten. Häufiger gibt es eine Art Unbehagen und den Versuch, mehr darüber zu erfahren. Ein Eigentümer hat die Objekte freiwillig restituiert.
Bewertung
Respekt Nicola Kuhn: ‚Der Chinesischen Paravent‘ ist geradezu vorbildlich.
- Die Autorin schreibt eher nüchtern, ohne allzu viel Emotionen, aber gut lesbar und nicht langweilig. Sie vermeidet Besserwisser-Emotionalität der Spätgeborenen oder verquasten Unistil. Weckt also weder Reminiszenzen an die ‚gute alte Zeit‘. Noch verurteilt sie aus heutiger Sicht mit Schaum vor dem Mund.
- Sie nimmt die Objekte zum Anlass, ihre Geschichte und die ihrer europäischen und, soweit möglich, indigenen Besitzer zu erforschen. Und dabei auch zu erzählen, was sich heute in Bezug auf die Sicht auf den Kolonialismus verändert hat. Was Objekte zu erzählen haben – eine Herangehensweise, die deutsche ethnologische Museen immer weniger beherrschen.
- Sie verknüpft also die kleine private Welt mit der großen Welt draussen, mt kolonialer Geschichte.
- Sie nimmt die Artefakte, aus denen sich die Geschichten entwickeln, ernst und versucht auch, etwas darüber zu sagen, wie sie vor Ort verwendet wurden, welche Bedeutung sie hatten. Damit geht sie einen Schritt weiter als zum Beispiel Anne Haeming in ihrem ebenfalls sehr lesenswerten ’Der gesammelte Joest‘.
- Es geht nicht um die aus Sicht des Kunstmarktes wertvolle außereuropäische Kunst, die heute beim Thema ‚Raubkunst‘ immer ins Feld geführt wird, wie Artefakte aus Benin, Dahomey oder neuerdings aus Kamerun. Sondern um Dinge, die kaum einen monetären Wert haben, wie etwa ein Hocker der Nupe. Also um Objekte die sich vielleicht wirklich noch im Haushalt der eigenen Familie finden.
- Außerdem ist sie so differenziert, was die Art des Erwerbs der Objekte angeht, wie ich es in letzter Zeit selten erlebt habe. Ob es sich um Beutekunst handelt oder ob die Objekte durch Tausch, Kauf, Verhandlung etc. den Besitzer gewechselt haben, bleibt offen, wenn es keine eindeutigen Belege gibt. Natürlich kann man sich, wie es wohl auch die Autorin tut, fragen, ob es in kolonialen Unrechtsverhältnissen überhaupt so etwas wie einen Erwerb auf Augenhöhe geben kann. Sie lässt dies aber als Frage im Raum stehen, nicht aber als absolute Wahrheit, die es im Schwarz-Weiß-Denken zu verteidigen gilt.
- Sie nimmt aber nicht nur die Objekte, sondern auch die Besitzer ernst. So sachlich wie möglich beschreibt sie die Menschen, die die Objekte mitgebracht haben, und versucht daneben, auch die heutigen Besitzer nicht zu bewerten. Auch wenn man förmlich spürt, wie schwer es ihr beispielsweise bei von Wissmann fällt, die Fassung zu bewahren.
- Dabei beschönigt sie aber in keiner Weise den deutschen Kolonialismus, sondern beschreibt ihn als so verabscheuungswürdig, wie er war.
- Sie weckt beim Leser den Wunsch, selber auf Entdeckungsreise zu gehen, mehr über die eigene Familie zu erfahren, was sie zum Beispiel in der Kolonialzeit oder auch in den letzten Kriegen gemacht hat. Man möchte danach nach alten Familienstücken suchen und sie zum Anlass für eigene Recherchen zu nehmen. War mein Großvater zum Beispiel auf einem Minensucher, wie er mir kurz vor seinem Tod vor 55 Jahren erzählte, oder war er auf einem U-Boot, wie meine Mutter es mir sagte, und kann ein Foto von ihm in Marineuniform darüber Auskunft geben?
- Das Buch ist damit eine Chance, mehr über den deutschen Kolonialismus zu erfahren. Durch die Verknüpfung mit Objekten und auch mit einzelnen Personen ist es Geschichtsunterricht, der einen berührt.
Der chinesische Paravent ist ein großartiges Buch und eine Art positiver Widerspruch: Ein Werk, das die grausame Verstrickung Deutschlands in den Kolonialismus thematisiert und eher nüchtern geschrieben ist. Aber dennoch Lust macht, in deutsche Geschichte einzutauchen - und in die Geschichte der eigenen Familie. Auch wenn dies eventuell unbequeme Wahrheiten zu Tage fördert.
Wer das Buch kaufen und mir einen Gefallen tun möchte, kann es versandkostenfrei über Thalia bestellen. Ich nehme an deren Partnerprogramm teil und erhalte pro über den Link verkauftem Buch eine kleine Provision. Für den Käufer bleibt der Preis gleich. Natürlich kann man sich über diese Links auch informieren, ohne zu bestellen. (Beim Draufklicken auf den Link wird ein Cookie gesetzt.)
Der chinesische Paravent. Wie der Kolonialismus in deutsche Wohnzimmer kam von Nicola Kuhn
368 Seiten, Verlag dtv, 2024
Zum Thalia-Link zum gebundenen Buch für 25 Euro
Zum Thalia-Link zum eBook für 19 Euro
Vielen Dank an die dtv Verlagsgesellschaft für das Rezensionsexemplar