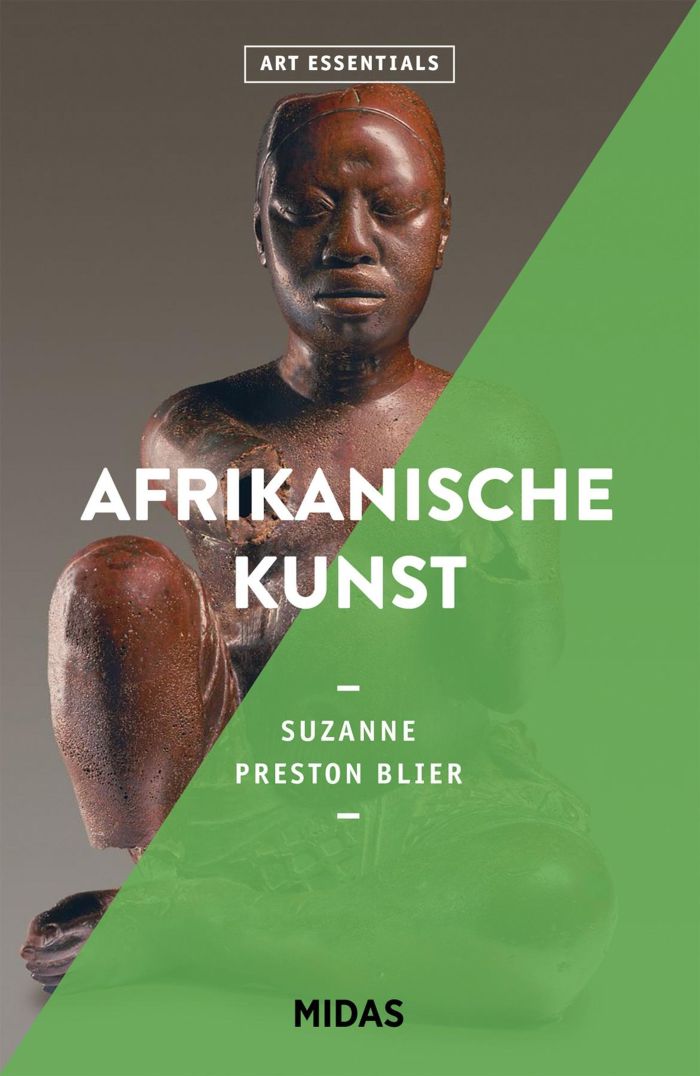Der MIDAS-Verlag veröffentlicht in seiner Buchreihe ‚Art Essentials‘ in der Regel 176-seitige Einführungen zu Themen wie ‚Abstrakte Kunst‘, ‚Fotografie‘ oder ‚Frauen in der Kunst‘. Mit dem in dieser Reihe 2024 in deutscher Sprache erschienenen Werk ‚Afrikanische Kunst‘ ist der Autorin, der amerikanischen Kunsthistorikerin Suzanne Preston Blier, ein großer Wurf gelungen.
Inhalt
Im ersten Kapitel ‚Afrikanische Kunst erleben‘ gibt Blier einen Überblick, der vom 14. bis ins 20. Jahrhundert reicht. Dabei geht sie auf einzelne Kunstobjekte ein und interpretiert sie prägnant und kompetent. Zum Beispiel, dass Raphia-Stoffe der Mbuti aus der Vogelperspektive Ranken und Baumkronen zeigen.
Oder dass eine Maske der Mende weibliche Schönheitsideale suggeriert: Die hohe Stirn stehe für Intelligenz, der kleine Mund für Bescheidenheit und Demut, die Wellen im Nacken für Gesundheit, Wohlstand und Wasserwellen. Letztere erinnern "an den Geist von Sande, der aus dem Wasserbecken aufsteigt".
Eines ihrer Hauptanliegen: Zu zeigen, wie sich afrikanische und ‚westliche‘ Kunst über Jahrhunderte hinweg beeinflusst haben, zum Beispiel durch regen Handel. Afrika war eben nicht nur der dunkle, unbekannte Kontinent. So sind auf einem Bronzeschild aus Benin unter den Füßen eines Herrschers Schlammfische zu sehen. Das erinnert an Sirenenbilder aus dem Mittelmeerraum und der afrikanischen Welt von der Antike bis heute.
In die gleiche Richtung geht ihre Beobachtung, dass „Gewand, Schmuck und Krone“ einer Ogboni-Bronze aus dem 14. Jahrhundert ihre Wurzeln wahrscheinlich in der koptischen Welt haben.
Im Kapitel ‚Alte Kunst‘ verweist sie auf Kunstformen, die von 400.000 v. Chr. (Körperbemalung) über die ägyptische Kunst bis zu den Werken der NOK oder den Monolithen im Cross-River-Gebiet gehen.
Spannend fand ich, dass die Motive der Felsbilder in der Sahara bei der Datierung helfen. So sind Kamele ab 700 v. Chr. zu sehen, während die Büffelzeit von 7000 bis 4000 v. Chr. reicht.
Das ‚Mittelalter‘ war für Afrika „eine Zeit des Reisens und des Handels innerhalb des Kontinents und darüber hinaus“. Damals war Afrika „eine der reichsten Regionen der Welt“ und es gab innovative Technologien wie den Metallguss im Wachsausschmelzverfahren. Christentum und Islam hatten einen starken Einfluss auf afrikanische Werte - aber auch umgekehrt!
Die afrikanische Kunst (wie auch die europäische, siehe Gotik) erlebte ein „goldenes Zeitalter“. Als Beispiele nennt Blier die Bronzekunst von IFE, die Terrakotten von Djenné, die Figuren der Tellem, aber auch das berühmte goldene Nashorn von Mapungubwe, das in Südafrika ausgestellt ist.
Das Mittelalter endet für die Autorin mit dem ‚Schwarzen Tod‘ Mitte des 14. Jahrhunderts, der auch in Afrika wütete.
In den ‚Transformationen der Frühen Neuzeit‘ begann der massive Einfluss der Europäer, sei es durch Sklavenhandel oder auch durch Missionsbestrebungen. Schon früh wurde beispielsweise das Königreich Kongo christianisiert. Herausragende Kunst entstand im Kongo und später in Kuba. Daneben auch im Königreich Benin, in Dahomey und im Aschanti-Reich: Gebiete mit intensivem Sklavenhandel (und Reichtum).
In ‚Historische Vermächtnisse“ geht die Autorin auf die als klassisch geltende traditionelle afrikanische Kunst ein, wobei sie sich auf das Kongobecken, das Niger-Benue-Flusssystem und das Niger-Binnendelta in Mali konzentriert. Bemerkenswert ist zum Beispiel eine kurze Bildbeschreibung einer weiblichen Bieri-Figur der Fang: Ihr Körper und ihre Gestalt deuteten sowohl auf eine weibliche Form als auch auf die eines Kleinkindes hin. „Beide Darstellungen entsprechen den Rollen, die von den Ahnen eingenommen werden, um neue Kinder in diese Welt zu bringen“.
Blier betont jedoch, dass diese ‚klassische‘ Kunst nicht statisch war, sondern Veränderungen unterlag. Gesammelt wurde sie zumeist in der Kolonialzeit - wohl oft ohne Raubkunsthintergrund.
In den ‚Transformationen der Frühen Neuzeit‘ begann der massive Einfluss der Europäer, sei es durch Sklavenhandel oder auch durch Missionierungsbestrebungen. Schon früh wurde beispielsweise das Königreich Kongo christianisiert.
Das Kapitel ‚Die Kolonialzeit (1850-1959)‘ nimmt nur ein Zehntel des Buches ein. Darin beschreibt sie aber sehr differenziert verschiedene Ansätze, wie afrikanische Künstler auf diese "unruhige Zeit" reagierten.
So wurden Objekte hergestellt, die den afrikanischen Truppen in den Kriegen helfen sollten. Ein Beispiel ist die berühmte Eisenfigur des Schmieds Akati, die den Kriegsgott Gu darstellt. Die Kriegerstatue sollte die Armee von Dahomey gegen die französischen Truppen unterstützen. Sie steht im Louvre. Akati selbst war damals Gefangener.
Oder der lebensgroße Löwenmensch, der an die Republik Benin zurückgegeben wurde. Löwenmotive sind in Afrika eher selten und wurden, wie sie sagt, durch die europäische Heraldik beeinflusst.
In der Kolonialzeit entstanden auch die so genannten Colons, die häufig Europäer darstellen. Eine weitere Entwicklung: Kunstwerke zu Ehren von Helden der Vergangenheit wie Tchibinda Ilunga, dem Gründer des Chokwe-Königreichs.
Olowe of Ise wirkte schließlich in Nigeria auch mit finanziellen Mitteln, die lokale Herrscher von den Briten erhielten, um die Region zu stabilisieren.
Kampf gegen die Europäer, Spiegelung des Fremden, Verherrlichung der Vergangenheit und der Versuch, eine neue Ordnung zu schaffen. Die künstlerischen Reaktionen Afrikas auf den Kolonialismus waren vielfältig.
In einem recht kurzen Kapitel geht die Autorin schließlich auf die ‚zeitgenössische afrikanische Kunst‘ ein. Besonders beeindruckt hat mich die Arbeit ‚Corps en mutation‘ von Freddy Tsimbas. Diese über zwei Meter hohe Installation erinnert an die „brutale koloniale Vergangenheit“ des Kongo, aber auch daran, dass die Diktatur Mobutu diese fortgesetzt hat und sie eigentlich bis heute nicht verschwunden ist - siehe den Kampf um Rohstoffe.
Das Buch schließt mit ‚Reflexionen und Vergleichen‘.
Bewertung
In letzter Zeit erscheinen häufiger Bücher, die Afrika nicht als isolierten dunklen Kontinent zeigen, sondern als Teil der Weltgeschichte, der seit Jahrhunderten mit anderen Regionen verbunden ist - mit gegenseitigen künstlerischen und kulturellen Einflüssen. Ein in dieser Hinsicht gelungenes Werk mit dem Schwerpunkt afrikanische Kunst ist Kerstin Plinthers ‚Die Kunst Afrikas‘, siehe meine Rezension.
Warum finde ich Suzanne Bliers "Afrikanische Kunst" noch besser?
Das liegt vor allem daran, dass sie sich in Text und Bildbeschreibung nicht scheut, einzelne Objekte zu interpretieren. Ich bin immer auf der Suche nach Geschichten, mit denen man den Menschen die afrikanische Kunst näher bringen, Aha-Erlebnisse liefern kann. Und genau solche Geschichten bietet dieses Buch mit seinen Erläuterungen. Was die Ästhetik einer Mende-Maske aussagt, wie sich Sirenenwesen in der afrikanischen Kunst widerspiegeln, was auf Raphia-Stoffen zu sehen ist und so weiter und so fort. Blier macht das, wofür sie als Kunsthistorikerin ausgebildet ist: Sie interpretiert und geht hier deutlich weiter als Plinther.
Außerdem macht sie keinen großen Unterschied zwischen höfischer und ruraler Kultur. Letztere kommt bei Plinther deutlich zu kurz.
Daneben ist Blier auch eine typische anglo-amerikanische Wissenschaftlerin: Sie bleibt immer lesbar!
Hat das Buch Schwächen? Teilweise kamen mir der Kapitelinhalt nicht immer logisch vor. Manche Themen/Objekte hätten auch in andere Kapitel gepasst. Daneben gibt es Regionen, die öfters vorkommen als andere. Sei es der Kongo oder Nigeria. Aber irgendwo musste sich die Autorin beschränken. Diese ‚Schwächen‘ sind aber nichts im Vergleich zu den Stärken.
Mein Fazit: Ich werde oft gefragt, wie man Menschen für afrikanische Kunst begeistern kann. Von nun an werde ich auf ‚Afrikanische Kunst‘ von Suzanne Preston Blier verweisen.
Ingo Barlovic
Wer das Buch kaufen und mir einen Gefallen tun möchte, kann es versandkostenfrei über Thalia bestellen. Ich nehme an deren Partnerprogramm teil und erhalte pro über den Link verkauftem Buch eine kleine Provision. Für den Käufer bleibt der Preis gleich. Natürlich kann man sich über diese Links auch informieren, ohne zu bestellen. (Beim Draufklicken auf den Link wird ein Cookie gesetzt.)
Afrikanische Kunst von Suzanne Preston Blier
176 Seiten, Verlag MIDAS, 2024
Zum Thalia-Link zum Taschenbuch für 17,90 Euro
Vielen Dank an den Verlag MIDAS für das Rezensionsexemplar