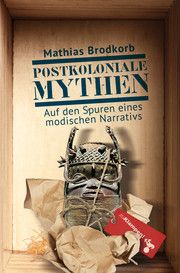Mathias Brodkorb, Journalist, SPD-Politiker und ehemaliger Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie Finanzminister in Mecklenburg-Vorpommern, ist bekannt für seine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Themen. Er befasste sich u.a. mit der Erforschung rechtsextremistischer Ideologien und ist Kolumnist des Monats-Magazins Cicero.
In seinem 2025 erschienenen Buch „Postkoloniale Mythen – Auf den Spuren eines modischen Narrativs“ geht er dem Thema Postkolonialismus kritisch nach und macht dies vor allem an den Entwicklungen in deutschen ethnologischen Museen fest. Laut Wikipedia beschreibt der Begriff „Postkolonialismus” ein „dialektisches Konzept”, das „einerseits die politische Souveränität der ehemaligen Kolonien gegenüber ihren Kolonialmächten zugrunde legt, andererseits aber ein Bewusstsein für das Fortbestehen imperialistischer Strukturen in verschiedenen Lebensbereichen, wie beispielsweise der Politik und Ökonomie, schaffen will.“
Inhalt
Nach einem Geleitwort von Andreas Schlothauer führt Brodkorb in das Thema ein. Er kritisiert, dass der Postkolonialismus auch in deutschen Museen häufig als vereinfachendes Narrativ präsentiert werde: Weiße erscheinen ausschließlich als koloniale Täter, Schwarze ausschließlich als unschuldige Opfer. Brodkorb widerspricht dieser Sichtweise und verweist darauf, dass Sklaverei bereits vor dem europäischen Kolonialismus in Afrika existierte – sowohl durch innerafrikanischen als auch durch arabischen Sklavenhandel. Diese Aspekte, so Brodkorb, würden von Vertretern des postkolonialen Diskurses oft ausgeblendet. Zudem hebt er hervor, dass es auch weiße Opfer und schwarze Täter im Kontext des Sklavenhandels gab.
Im Kapitel „Reichstag“ beleuchtet Brodkorb die Debatten rund um Kolonialismus und Sklaverei im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Er zeigt, dass bereits zur Zeit Bismarcks differenzierte Positionen existierten, und kritisiert, dass der Film „Der vermessene Mensch“ von Lars Kraume bestimmte Fakten auslässt oder verzerrt darstellt, um „die Schlichtheit des moralischen Bildes“ nicht zu stören.
Das Kapitel „Benin City“ nutzt Brodkorb, um auf die Gräueltaten der Regime von Benin, einschließlich Menschenopfern, hinzuweisen. Er plädiert dafür, einfache Gut-Böse-Erzählungen zu hinterfragen.
Das „postkoloniale Narrativ“ fasst Brodkorb in drei Leitideen zusammen:
- Rassismus/Humanismus: Rassismus werde als ausschließlich westliches Phänomen dargestellt, während der Humanismus als Märchen abgetan werde.
- Sklaverei/Kolonialisierung: die ebenfalls „ausschließlich Kinder des weißen Westens“ seien
- Schwarze Unschuld: Die Rolle schwarzer Akteure werde auf die des unschuldigen Opfers reduziert.
In weiteren Kapiteln untersucht Brodkorb die Umsetzung postkolonialer Narrative in verschiedenen deutschsprachigen Museen:
- In Leipzig sollen nach der ehemaligen Direktorin Meyer-van Mentsch die Gebote der Museumsarbeit (Sammeln und Bewahren) der „Leitidee der historischen Gerechtigkeit“ unterstellt werden. So wurden beispielsweise die Benin-Bestände ins Depot überführt.
Dazu wird die Künstlergruppe PARA unterstützt. Sie möchte einen Stein, den Hans Meyer vor über 100 Jahren wohl vom Kilimandscharo mitgenommen hat, öffentlichkeitswirksam nach Tansania zurückführen. Der Verleger Meyer war maßgeblich am Erwerb der Leipziger Benin-Bronzen beteiligt. Diese sehr skurril wirkende Künstleraktion gibt Brodberg die Chance, differenziert auf Meyers Bergexpedition zu schauen und u. a. auf dessen Freundschaft zu Häuptling Mareala „vom Volk der Dschegga“ zu reflektieren. Koloniale Erzählungen sind nicht immer einfach. - Im Berliner Humboldt Forum kritisiert Brodkorb die einseitige Darstellung der Beziehungen zu den Bamun, insbesondere im Hinblick auf den Thron von König Njoya.
- In Wien macht Brodkorb die gleiche Beobachtung, die auch ich bei meinem Besuch des Weltmuseums gemacht habe: Man ist geradezu krampfhaft bemüht, koloniale Schuld auf sich zu nehmen, obwohl Österreich doch so gut wie gar nicht an kolonialen Bestrebungen beteiligt war.
Übrigens war Jonathan Fine, der ehemalige Direktor, anscheinend der einzige Museumschef, der nicht mit Brodkorb reden wollte. - In Hamburg versuchte die Direktorin Barbara Plankensteiner laut Brodkorb mit Erfolg, „das Haus auf die Rolle des Hauses in der Geschichte des Welthandels und den Kolonialismus auszurichten und zugleich ein familienfreundliches Ausstellungsgesicht zu entwickeln.“
Dabei wirkt das MARKK nach Ansicht des Autors wie ein „musealer Flohmarkt“. Immerhin denkt er, die Benin-Ausstellung sei gelungen. Und da bin ich ganz seiner Meinung, auch wenn sie natürlich die Kritik an den Obas auslässt. (Siehe dazu mein Video.)
Anlässlich einer aus meiner Sicht sehr interessanten Ausstellung geht Brodkorb intensiv auf den „Justizmord“ an Duala Manga Bell ein. Peter Heller hat dazu Filme gemacht.
Das Buch schließt mit einem Bericht von der Biennale in Venedig, wo Brodkorb erneut das Narrativ vom „weißen Westen“ als „immerwährenden Täter“, und „unschuldigem Afrika als dessen hilfloses Opfer“ als Opfer thematisiert.
Bewertung
Grundsätzlich war ein solches Buch mehr als nötig! In den letzten Jahren wurden postkoloniale Mythen viel zu sehr durch die medialen Dörfer getrieben, ohne dass es nennenswerten Widerspruch gab. Wenige Ausnahmen waren zum Beispiel die FAZ mit Andreas Kilb oder auch Brigitta Hauser-Schäublin. Und natürlich das Raubkunst Buch von Karl-Ferdinand Schädler, das leider die öffentliche Diskussion nur sehr wenig prägen konnte.
Dabei versucht Brodkorb, die Leser meist sehr anschaulich auf seine Reise in das modische Narrativ mitzunehmen. Er verknüpft dies mit Aktivitäten von ethnologischen Museen und erzählt sehr detailliert, welche Hintergründe verfälscht oder ausgelassen wurden, um postkoloniale Mythen zu verbreiten.
Allerdings überzeugt nicht jeder Aspekt gleichermaßen. Insbesondere in der Einleitung fokussiert sich Brodkorb stark auf das Thema Sklaverei, während andere Facetten des Postkolonialismus, etwa die Auswirkungen westlicher Kolonialpolitik, etwas zu kurz kommen. Die Tatsache, dass auch afrikanische Herrscher an kolonialen Verbrechen beteiligt waren, relativiert die Verantwortung des Westens nicht, sondern ergänzt das Bild um notwendige Nuancen.
Für wen lohnt sich die Lektüre von „Postkoloniale Mythen“, wer ist die Zielgruppe?
Zielgruppe
- Für Leser, die sich mit dem Thema schon kritisch auseinandergesetzt haben, bringt das Buch Bestätigung und Kopfschütteln über postkoloniale Aktivitäten, aber eigentlich wenig, was die eigene Denkweise kritisch hinterfragt oder erweitert. Es ist eine nachvollziehbare Bestätigung der eigenen Meinung
- Anhänger des postkolonialen Narrativs könnten durch das Buch einige Ansätze zum Überdenken der eigenen Meinung erhalten, aber diese werden Brodkorbs Buch wohl kaum zur Kenntnis nehmen. Schließlich steckt man fest in seiner Blase bzw. Community.
- Bleiben die Leser, die dem Thema ohne Vorurteile gegenübertreten: Ja, für diese wäre das Buch gewinnbringend, wäre da nicht das Problem mit dem richtigen Zeitpunkt.
Denn irgendwie ist dieses Buch etwas zu spät dran: Die Aufregung um Postkolonialismus hat sich in der Öffentlichkeit gelegt. Es wird von den Mainstream-Medien kaum noch aufgegriffen, dazu verschwinden Themen wie kulturelle Aneignung oder auch Wokeness immer mehr in kleinen Filterblasen – sei es von Aktivisten oder von Museen. Damit käme Brodkorbs Buch eigentlich zur richtigen Zeit, weil es kaum noch Gegenwind dagegen gibt. Andererseits erscheint es halt zu einer Zeit, in der es in der Öffentlichkeit wohl kaum noch überhitztes Interesse daran gibt.
Fazit
„Postkoloniale Mythen“ ist eine gelungene Abrechnung mit postkolonialen Mythen. Es ist eine Einladung, komplexe historische Zusammenhänge differenziert zu betrachten – auch wenn der gesellschaftliche Diskurs sich bereits weiterentwickelt hat und diese Mythen in der Öffentlichkeit an Brisanz verloren haben. Ein wenig ist es ein Kampf gegen Windmühlen.
Ingo Barlovic
Wer das Buch kaufen und mir einen Gefallen tun möchte, kann versandkostenfrei über Thalia bestellen. Ich nehme an deren Partnerprogramm teil und erhalte pro über den Link verkauftem Buch eine kleine Provision. Für den Käufer bleibt der Preis gleich. Natürlich kann man sich über diesen Link auch informieren, ohne zu bestellen. (Beim Draufklicken auf einen Link wird ein Cookie gesetzt.)
Postkoloniale Mythen - Auf den Spuren eines modischen Narrativs. Eine Reise nach Hamburg und Berlin, Leipzig, Wien und Venedig. Von Mathias Brodkorb
272 Seiten, 2025, Zu Klampen Verlag
Zum Thalia-Link zur gebundenen Ausgabe für 28 Euro
Zum Thalia-Link zum eBook für 20,99 Euro
Vielen Dank an den zu Klampen Verlag für die Zusendung eines Rezensionsexemplars